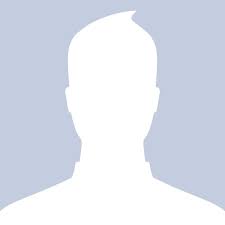Der vorliegende Beitrag befasst sich mit dem Stand des Wissens zu Gewalt- und Traumafolgen. Traumata werden definiert als Ereignisse von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß. Hierzu zählt auch die Verletzung der physischen Integrität durch physische und sexualisierte Gewalt. Neben der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) kann es in der Folge extrem belastender Erfahrungen auch zur Entwicklung einer komplexen PTBS, einer anhaltenden Trauerstörung oder einer Anpassungsstörung kommen. Als indirekte Traumafolgestörungen zählen u. a. Depression, Substanzabhängigkeit und Persönlichkeitsstörungen. Diese treten oft gemeinsam (komorbid) mit einer PTBS auf. Die Wahrscheinlichkeit, jemals im Leben eine PTBS zu entwickeln, liegt in Deutschland zwischen 1 und 4 %. Eine PTBS wird diagnostiziert, wenn über einen längeren Zeitraum die traumatische Situation unwillkürlich wiedererlebt wird (z. B. in Bildern oder Träumen), mögliche Hinweisreize vermieden werden, die allgemeine Reagibilität abgeflacht ist und eine permanente Überregung vorliegt. Die Intensität, Dauer und Häufigkeit von traumatischen Ereignissen stellen ebenso Risikofaktoren für die Entwicklung einer PTBS dar wie eine mangelnde soziale Unterstützung nach dem Trauma. In den letzten beiden Jahrzehnten wurden erfolgreich Methoden zur Therapie der PTBS entwickelt. Die Exposition gegenüber dem traumatischen Ereignis steht im Mittelpunkt der als erfolgreich evaluierten Psychotherapien. Die beste Wirksamkeit bei der Behandlung einer PTBS weisen verhaltenstherapeutische Ansätze auf. Ein besseres Verständnis der Folgen von Gewalt und Traumata könnte uns in Zukunft helfen, Personen mit einem besonderen Risiko für Traumafolgestörungen frühzeitig zu erkennen.