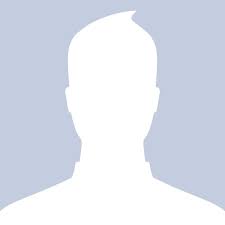Die Schlussfolgerung, dass Vögel auf geruchlicher Basis mit Hilfe atmosphärischer Spurenstoffe aus unbekannten Gebieten zu ihrem Heimatort zurück finden, ergibt sich nicht, wie frühere Hypothesen über. das Heimfindevermögen, aus einem theoretischen Ansatz, sondern aus einer Reihe von Experimentalbefunden. (1) In entfernte fremde Regionen verfrachtete Brieftauben fliegen nur dann heimwärts, wenn sie riechen können; Tauben mit durchtrennten Geruchsnerven fliegen zwar oft weite Strecken, nähern sich aber nicht der Heimat. Weitgehend analoge Behandlungen der Versuchs- und Kontrollvögel machen es sehr unwahrscheinlich, dass das Versagen der Ersteren auf geruchsunabhängigen Nebenwirkungen beruht. (2) Die Entfernung von Spurengasen aus der Atemluft durch Aktivkohlefilter vor der Auflassung, kombiniert mit nasaler Lokalnarkose während des Abflugs, verhindert heimgerichtete Abflüge, während die Lokalnarkose allein (nach dem Riechen ungefilterter Luft am Auflassort) das nicht tut. (3) Tauben, die an einem Ort der natürlichen Umgebungsluft exponiert, aber dann ohne Zugang zur natürlichen Luft an einem entgegengesetzt gelegenen Ort aufgelassen werden, fliegen so ab, als wären sie am olfaktorischen Expositionsort und nicht am tatsächlichen Auflassungsort. (4) Langfristiges Abschirmen des Windes in der Heimatvoliere bewirkt völliges Versagen der Heimorientierung, Umlenken oder Umkehren des Windes bewirkt voraussagbare Ablenkung oder Umkehrung der Abflugrichtungen am Auflassort. (5) Aus durch frühere Flüge bekannten Gebieten ist auch nicht-olfaktorisches Heimfinden möglich. Es ist durch Nutzung visueller Landschaftskenntnis erklärbar.