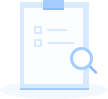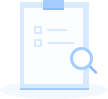Mit der Digitalisierung sind große Erwartungen an eine Individualisierung von Präventions- und Versorgungskonzepten und die Verbesserung von Qualität und Effizienz in der Leistungserbringung verknüpft. Big-Data-Ansätze, die auch die Daten aus Lebenswelten und Alltag z. B. aus digitalen Gesundheitsanwendungen (Apps, Wearables) einbeziehen, sowie die digitalen Möglichkeiten, Bewertungen und Präferenzen von Patienten in stärkerem Maße erfassen und berücksichtigen, lassen den Patienten stärker in den Mittelpunkt rücken. Computergestützte Prozesse und Analysen wecken die Hoffnung auf bürokratische Entlastung und auf neue Freiräume für die Arzt-Patient-Beziehung. Voraussetzung dafür sollen mit einer sicheren Telematikinfrastruktur (TI) geschaffen werden, die Daten über Sektorengrenzen hinweg sammeln und austauschen kann. Die im Zentrum der TI stehende elektronische Patientenakte soll jederzeit und überall den Zugriff auf Gesundheitsdaten ermöglichen und über digitale Wege die Kommunikation zu Leistungserbringern vereinfachen. Um den Erfolg telemedizinischer Pilotprojekte und digitaler Gesundheitsanwendungen (z. B. Apps) transparent zu machen und schnell in die Breitenanwendung zu überführen, bedarf es effizienter Forschungsförderung, die Evaluationsmethoden und Qualitätsstandards hervorbringt. Die Nutzung dieser digitalen Versorgungsangebote bleibt freiwillig und leitet sich ebenso aus der informationellen Selbstbestimmung ab wie das Recht zu entscheiden, wofür und wie Gesundheitsdaten genutzt werden. Um Chancen und Risiken informiert und selbstbestimmt abwägen zu können, sind Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und der digitalen Kompetenz von Bürgern und Patienten sowie aller in digitalen Versorgungsprozessen involvierter Akteure von großer Wichtigkeit.