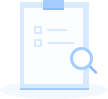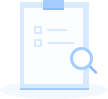Die Sozialstrukturforschung der 80er Jahre war gekennzeichnet durch eine zunehmende Infragestellung der klassischen Sozialstrukturmodelle in Gestalt von Klassen-und Schichtkonzeptionen. Mit dem Verweis auf die Erscheinungen des sozialen Wandels, wie Pluralisierung der Lebensformen und Diversifizierung von Lebensbedingungen, wurde die Erklärungskraft dieser Gesellschaftsmodelle zunehmend in Zweifel gezogen. In der Reaktion entstanden Neukonzeptionen in Form von Lebensstil-und Milieumodellen, die in Abkehr zu den klassischen Konzeptionen subjektive Sozialstrukturdimensionen, wie Lebensstile und Wertorientierungen, in den Mittelpunkt rückten. Diese Umorientierung hat auch die Sozialepidemiologie nicht unberührt gelassen. Obwohl nach wie vor Zusammenhänge zwischen der sozialen Lage und den Gesundheitschancen nachgewiesen wurden, stand auch hier die Frage zur Disposition, ob die konventionellen Schicht-und Klassenmodelle noch in der Lage sind, die heterogenen Gesundheitsdeterminanten zu erfassen oder ob dies nicht die alternativen Milieu-und Lebensstilkonzeptionen besser leisten können. Damit einhergehend stand auch der, verhältnisbezogene Erklärungsansatz ’für die Entstehung gesundheitlicher Ungleichheit zur Disposition. In den letzten Jahren mehrt sich nunmehr die Kritik an den Neukonzeptionen, die sich vor allem auf die Vereinseitigungen der Subjektdimension bezieht. Inzwischen ist der Höhepunkt in der Auseinandersetzung überschritten und die Diskussion hat insgesamt an Brisanz verloren. Trotzdem ist die Frage nach den sozialstrukturell relevanten Ungleichheitsdimensionen immer noch ungeklärt und die Unsicherheit bei der konzeptionellen Ausgestaltung einer Sozialstrukturanalyse entsprechend hoch. In diesem Beitrag wird für den Bereich der sozialepidemiologischen Forschung eine Weiterführung der Diskussion angeregt und für eine Integration sowohl, alter ’als auch, neuer ’ für die Sozialepidemiologie relevanten Sozialstrukturdimensionen im Rahmen eines Mehrebenenmodells plädiert. Gleichzeitig werden damit die beiden Haupterklärungsansätze der Verhältnis-und verhaltensbezogenen Verursachung sozial bedingter gesundheitlicher Ungleichheit in einen systematischen Zusammenhang gebracht. Dazu werden die Kernargumente der jüngsten Debatte in der Sozialstrukturforschung noch einmal aufgerollt und dabei die Unzulänglichkeiten einer einseitigen Betrachtung sowohl der alten als auch der neuen Modelle herausgestellt. Als Ausgangspunkt für ein integratives Mehrebenenmodell wird die Bourdieusche Habitustheorie vorgestellt, in der eine vermittelnde Perspektive zwischen den traditionellen und den neuen Konzeptionen angelegt ist. Auf dieser Konzeption aufbauend wird schließlich ein Mehrebenenmodell entwickelt, welches die gesundheitsrele-vanten Variablen der neuen und alten Sozialstrukturmodelle und damit die beiden zentralen sozialepidemiologischen Erklärungsansätze in einen integrativen und theoretisch fundierten Zusammenhang stellt.